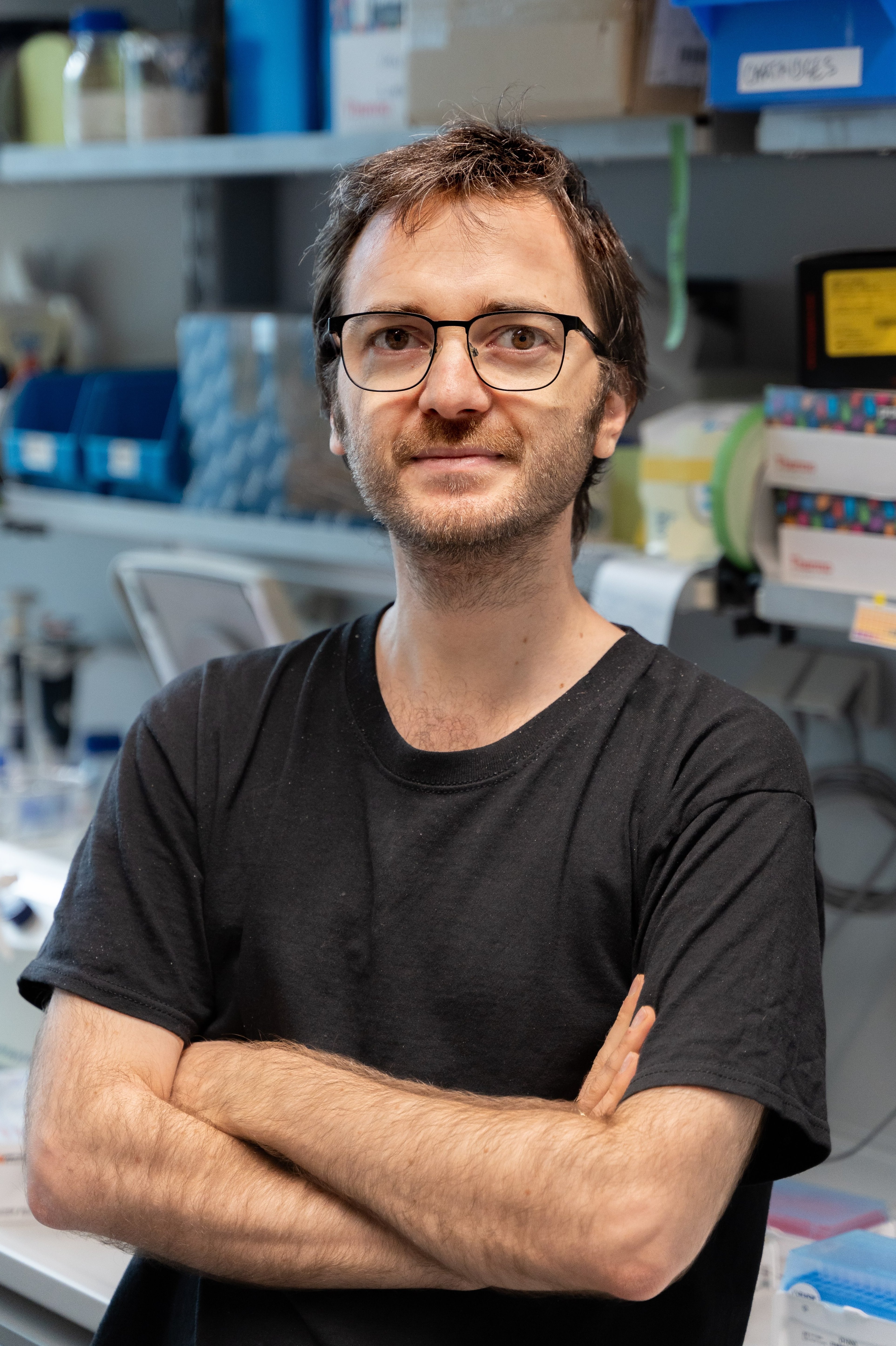
(Wien, 28-07-2025) Simon Licht-Mayer, Forscher am Klinischen Institut für Labormedizin der MedUni Wien, erhält eine Einzelprojekt-Förderung des Österreichischen Wissenschaftsfonds FWF. Er untersucht in seinem Projekt neuronale Adaptionen an Demyelinisierung. Der Verlust der schützenden Myelinschicht, die normalerweise viele Nervenfasern umgibt, führt in demyelinisierenden Erkrankungen wie Multipler Sklerose (MS) zu einer akuten, sowie fortschreitenden Schädigung der Axone (Nervenzellfortsätze).
Axonale Degeneration ist die Hauptursache für bleibende Schäden in Patient:innen mit MS. Neben MS tritt dieses Problem auch bei anderen demyelinisierenden Erkrankungen des zentralen (ZNS) und peripheren Nervensystems (PNS) auf. Vorhergehende Studien haben gezeigt, dass eine Demyelinisierung den Energiestoffwechsel der betroffenen Nervenzellen massiv beeinträchtigt. Mitochondrien – die zentralen Energieproduzenten der Zelle – spielen in diesen Prozessen eine Schlüsselrolle.
Bisherige Arbeiten von Simon Licht-Mayer und Kolleg:innen haben gezeigt, dass Nervenzellen auf den Verlust von Myelin mit einer gezielten Schutzantwort reagieren: Sie transportieren vermehrt Mitochondrien in die geschädigten Axone, um deren Energieversorgung aufrechtzuerhalten und die Degeneration zu verlangsamen. Diesen Mechanismus haben die Forscher:innen als den “axonal response of mitochondria to demyelination” (ARMD) bezeichnet. Besonders vielversprechend ist, dass sich diese Schutzantwort therapeutisch verstärken lässt, um Nervenschäden aktiv zu verhindern. Bisher ist jedoch unklar, wie genau diese Reaktion in den Nervenzellen gesteuert wird und wie sich die Veränderungen des mitochondrialen Transports auf den Abbau und die Zusammensetzung der Mitochondrien in demyelinisierten Axonen auswirken. Ebenso ist bislang nicht untersucht, inwieweit Alter und Geschlecht die Effizienz von ARMD beeinflussen.
In diesem Projekt will Simon Licht-Mayer daher untersuchen, wie diese Schutzantwort auf genetischer Ebene reguliert wird und welchen Einfluss sie auf den mitochondrialen Proteinaufbau und Abbau hat – sowohl nach Demyelinisierung als auch nach einer möglichen Remyelinisierung. Dazu werden die Forscher:innen spezielle Mausmodelle einsetzen, um Nervenzellen mit geschädigten Axonen zu markieren, was es ermöglicht, diese gezielt zu untersuchen. Parallel dazu werden sie Mitochondrien in betroffenen Axonen und deren Zellkörpern markieren und gezielt isolieren, um deren Zusammensetzung sowie deren Abbau nach De- und Remyelinisierung genauer zu untersuchen.
Abschließend werden sie ihre Ergebnisse an Gewebeproben von MS-Patient:innen überprüfen, um die klinische Relevanz ihrer Befunde zu bestätigen. Durch dieses integrative Vorgehen erwarten sich die Forscher:innen neue Einblicke in mitochondriale Schutzmechanismen, die langfristig helfen könnten, die fortschreitende Nervendegeneration bei MS und anderen demyelinisierenden Erkrankungen gezielt zu verhindern.
zur Person
Simon Licht-Mayer studierte Molekulare Biologie an der Universität Wien und absolvierte seine Masterarbeit im Labor von Hans Lassmann, wo er die Rolle von Nrf2 – ein anti-oxidativer Masterregulator – in Multiple-Sklerose-Läsionen untersuchte. Für sein Doktorat forschte er in Schottland an der University of Edinburgh, wo er in der Gruppe von Don Mahad die mitochondriale Dynamik nach Demyelinisierung untersuchte. Diese Arbeit beschrieb als erstes den „Axonal Mitochondrial Response to Demyelination“ (kurz ARMD), eine homeostatische Reaktion, welche die Anzahl der Mitochondrien im demyelinisierten Axon erhöht und mittels genetischer und pharmazeutischer Manipulation verstärkt werden kann, um demyelinisierte Axone zu schützen. Als Postdoktorand am Klinischen Institut für Labormedizin der MedUni Wien untersucht er derzeit in der Gruppe von Josef Penninger die genetischen Grundlagen der veränderten mitochondrialen Dynamik nach axonalem Schaden, mit dem Ziel, neue therapeutische Ansätze zu identifizieren.